|
Kardenanbau
um 1850
An
Waldrändern, am Ufer von Bächen oder auf anderen unbebauten
Flächen, so z.B. entlang der B 265 in der Gemarkung „Im
Äckerchen“ findet man eine selten gewordene Pflanze mit
lilafarbigen Blütenköpfen. Sie wird bis zu zwei Meter hoch
und entwickelt sich zu einem stacheligen Gesellen. Wir sprechen von
der Wilden Karde.
Eine
nahe Verwandte ist die hellviolett bis rot blühende Weberkarde.
Sie hat hakenförmige Stacheln. Man brauchte sie früher
unbedingt zum Aufrauen mancher Wollstoffe. Aber auch heute stellt sie
ein in der Tuchindustrie nicht ganz zu ersetzendes Raumittel dar.
Von
den getrockneten Kardenköpfen werden Spitze und Stielende so
beschnitten, dass sie eine ungefähr zylindrische Form erhalten.
Sie werden zu zweien und dreien auf eine Spindel gesteckt. So
entsteht eine kleine Rauwalze. Mehrere dieser Walzen ergeben durch
Zusammenfassung einen sogenannten Kardenstab, der dann in eine
Raumaschine eingesetzt wird.
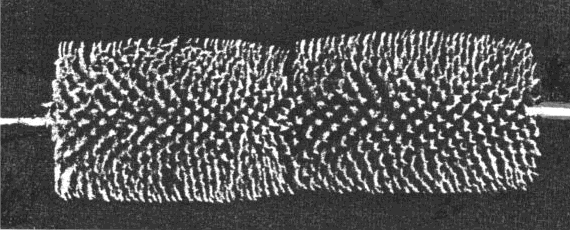
Rollkardenspindel
Bis
in die 1960er Jahre existierten in Düren, Euskirchen, aber vor
allen Dingen in Aachen und Monschau große Tuchfabriken. Die
Tuchindustrie von Aachen und Monschau bezog ursprünglich die
Weberkarden aus Südfrankreich. Aber bereits Ende des 18.
Jahrhunderts wurden Weberkarden auch im Raume Aachen angebaut. Um
1840 gelangten sie dann in unsere Gegend.
Zunächst
waren die Landwirte skeptisch. Aber schon bald zeigte sich, dass die
Karde auf mittleren Böden gut gedieh, und man damit viel Geld
verdienen konnte. Allerdings waren Anbau und Verarbeitung mühevoll.
Die
Aussaat erfolgte Anfang März. Im Juli oder August mussten die
Pflanzen ins freie Feld, etwa 50 cm auseinander, umgepflanzt werden.
Dort überwinterten sie. Die Karden waren von Unkraut
freizuhalten und mit Spaten oder Hacke anzuhäufeln. Mitte des
zweiten Sommers stand dann das Kardenfeld in Blüte. Unmittelbar
nach der Blütezeit begann der Schnitt der hakenstacheligen Köpfe.
Dafür brauchte man Lederhandschuhe. Die Köpfe wurden
abgeschnitten, und zwar mit einem etwa 10 cm langen Stängel.
Infolge der vielen Seitentriebe stand nicht die gesamte Pflanze in
Blüte. Für die später aufgehenden Blütenköpfe
war ein zweiter oder dritter Schnitt erforderlich.
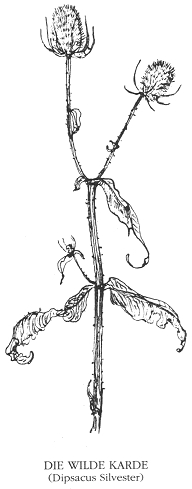
An
regenreichen und anderen arbeitsarmen Tagen oder am Abend beim Schein
der Petroleumlampe saß die ganze Familie beisammen und zog mit
einer großen Stopfnadel Schnüre durch die Blütenstiele.
Die dünnen Kordeln heißen daher auch heute bei uns noch
Kateköenche. 100 große oder
200 kleine Karden kamen auf eine Schnur. 20 Schnüre nannte man
eine Scheibe.
Die
aufgereihten Karden wurden in Scheunen, Toreinfahrten oder dem
Speicher zum Trocknen aufgehängt. Noch heute findet man bei
alten Bauernhöfen die inzwischen verrosteten langen Nägel
unter dem Dach oder der Suus (Tenne).
Der
Kardenanbau war zwar arbeitsintensiv und wegen der Stacheln
unangenehm, aber sehr rentabel. Durch den Krieg mit Frankreich
1870/71 stockte während der Kämpfe und auch eine gewisse
Zeit danach der Kardenimport aus Frankreich. Die Preise für die
einheimischen Pflanzen zogen stark an. Mit einem Morgen Land konnte
man 700 - 750 Mark erwirtschaften. Das war für die damalige Zeit
ungeheuer viel Geld. Einige Bauern gelangten damit zu Wohlstand.
Fuhrunternehmer
brachten die Karden auf von Pferden gezogenen Leiterwagen zu den
Tuchfabriken. Auch sie verdienten viel Geld und waren mit den
Transporten gut beschäftigt. In Embken soll es einen Fuhrmann,
Theodor Pütz, gegeben haben, der so oft Transporte ausführte,
dass er die Anzahl der Radumdrehungen bis Aachen kannte.
Die
goldene Zeit des Kardenanbaus dauerte für die hiesige Gegend nur
etwa 40 bis 50 Jahre. Mitte der 1880er Jahre ging sie allmählich
zu Ende. Unter dem 23.7.1890 fanden wir letztmalig eine
Zeitungsanzeige mit folgendem Wortlaut:
|
Starke
Kardenpflanzen
zu haben bei
Balth. Schumacher, Zülpich
|
|
Die
Weberkarde wurde weitgehend durch Metallkratzenwalzen bzw.
Kratzenrau- maschinen ersetzt.
|

Download
|
|
|